|
Die
Geschichte der Burgschule
|
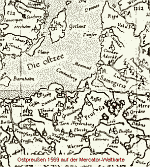
1525 verwandelt der Hochmeister
Albrecht
von Brandenburg den Ordensstaat in das weltliche Herzogtum Preußen
und führt in Preußen die Reformation ein.
|
.
|
Im Jahre 1255 wird im Zuge der
Besitzergreifung des Samlandes durch den Deutschen Ritterorden an
der Mündung des Pregels in das Frische Haff eine Burg gegründet
und zu Ehren König Ottokars von Böhmen, der sich an diesem Zug
beteiligte, 'Königsberg' genannt.
Um die Burg entstehen die Städte Altstadt, Löbenicht und Kneiphof.
1457 wird Königsberg Sitz des
Hochmeisters des Deutschen Ritterordens. |
1544 stiftet Herzog Albrecht
die Königsberger Universität, die "Albertina".

1657 erringt der Große Kurfürst
für Preußen die Souveränität.
Nach dem Vertrag von Wehlau 1657,
der Preußen von der polnischen Lehnshoheit befreite und die reformierte
Konfession in Preußen ausdrücklich als gleichberechtigt anerkannte,
faßte der Große Kurfürst den Entschluß, der reformierten
Gemeinde zu einem eigenen Kirchengebäude und einer eigenen Schule
zu verhelfen. Darauf wurde im Jahre 1658
die "evangelisch-reformierte Parochialschule in
Königsberg" gegründet. Der Unterricht wurde anfangs
in einem Mietshaus erteilt, das in der Nähe der Münze (officina
monetaria) gelegen war. Zur Unterhaltung der Schule wurde eine jährliche
Kollekte veranstaltet.
1658 nimmt die reformierte Schule
als Vorschule in einem Haus "an der Münze"
die Arbeit auf. [Das Gründungsjahr der Schule auf der Burg]
1664 verleiht der Große
Kurfürst in einer Schenkungsurkunde vom 17.
August der reformierten Kirchengemeinde einen Landbesitz von
hundert Hufen als materielle Grundlage für die zu unterhaltende Schule.
Die reformierte Lateinschule beginnt ihren Unterricht.
Den Bauplatz für Kirche und Schule hatte der Kurfürst
selbst ausgesucht und am 28. 2. 1662
seine Erwerbung verfügt, jedoch erst im Jahre 1665
der reformierten Gemeinde übergeben. In der Urkunde von 1665
heißt es:
"Wir Friedrich Wilhelm, bekennen, daß
nachdem auf vorhergehende unsere gnädigste Verordnung und Befehl von
unserer preußischen Regierung der auf unserer Burgfreiheit zu Königsberg
am Schloßteich gelegene Platz und Grund, ... der refornrtierten Gemeinde
daselbst zur Auferbauung einer offenen freien evangelischen Kirchen und
Schulen ... eingeräumt worden ist ."
Über die Örtlichkeiten heißt es in der "Geschichte
der Burgschule":
"Wenn man um das Jahr 1680 von der Französischen
Straße oder vielmehr vom "Thamm" (der den Schloßteich aufstauende
Damm, auf dem ein mit zwei Geländern eingefaßter Fußsteig
vom Burgkirchenplatz nach dem Schloß führte, wurde erst von
französisch-reformierten Flüchtlingen, also nach 1685,
bebaut) über den damaligen Schlachthof auf dem heutigen "Burgkirchenplatz"
zum Lehndorffschen Garten emporstieg, so hatte man zur Rechten die Burgschule,
ein zweistöckiges Gebäude, das trotz seiner Einfachheit und Schlichtheit
für die damalige Zeit ein recht stattliches Bauwerk darstellte".
Wann die Übersiedlung von dem Haus an der Münze in das eigene
Gebäude der Burgschule erfolgte, ist nicht bekannt.
1697 erweitert Kurfürst
Friedrich III. von Brandenburg den Landbesitz der Burgschule und sagt
in seiner Schenkungsurkunde:
"...der große Gott werde es nicht
ungestraft lassen..." und derjenige werde "einen schweren Fluch" auf sich
laden, der die reformierte Gemeinde je in ihren Rechten und Freiheiten
"auf einige empfindliche Weise kränke oder auch das Gotteshaus und
Schule zerstöre . . ." (Garantie der Glaubensfreiheit).
Die Burgschule, im Laufe der Zeit mit den Titeln "Reformierte
lateinische Parochialschule", "Reformierte
Lateinschule" und "Deutsch-Reformierte Schule"
versehen, hatte bald regen Zulauf. Sie soll sogar von Kindern von Engländern
und Schotten, die in Polen und Litauen wohnten, besucht worden sein.
Es wurden zunächst vier Klassen mit vier Lehrern eingerichtet,
später kam eine Stelle vorübergehend in Fortfall, erst ab 1813
wird eine fünfte Stelle eingerichtet, 1841
waren es schon neun, 1865 elf und 1914
fünfzehn.
Die relativ niedrige Zahl der Lehrer bis 1841
täuscht jedoch, denn es war damals üblich, sogenannte Kollaboratoren
zu beschäftigen, Studenten, die oftmals von den fest angestellten
Lehrern aus deren Gehalt bezahlt wurden. Ihre Zahl war zeitweise bedeutend
und betrug bis zu sieben, auch scheint ihr Unterricht nicht schlecht gewesen
zu sein, denn vom späteren Rektor Büttner, der an der
Schule als Kollaborator tätig war, heißt es, daß er in
dieser Stellung "schon bald eine wesentliche Stütze
der Anstalt" gewesen sei.
Ohne Zweifel haben aber die sehr schwankenden Erträge aus den Schulhufen
und die daraus resultierende geringe Bezahlung an die Lehrer starke Zumutungen
gestellt und die Burgschule mehr als einmal in ihrer Existenz bedroht und
in ihrem erzieherischen Niveau gedrückt. Denn oft haben fähige
Kräfte der Burgschule wegen ihrer zeitweise zu geringen Gehälter
den Rücken gekehrt.
Seit wann Schulgeld gezahlt wurde, ist nicht festzustellen, doch geht
aus einer Bemerkung aus dem Jahre 1747
die Abhängigkeit "der 'Revenüen' der Schulkasse
von der Anzahl der Schüler" hervor. Daß wir über
den Beginn der Schulgeldzahlungen kein genaues Datum angeben können,
verwundert nicht, denn die Einkünfte der Lehrer setzten sich damals
aus vielfältigen Beträgen zusammen. Neben dem Gehalt erhielten
sie freie Wohnung oder ein Wohnungsgeld, Holz oder Holzgeld, auch Deputat-Getreide
und Schulgeld. Zu den Nebeneinnahmen zählten Einkünfte aus den
Examina, Haustrauungen, aus der "Begleitung von Leichen''
(oft waren die Lehrer auch zugleich Prediger) usw.
Den Zweck der Burgschule hatte der Große Kurfürst darin
gesehen, daß
"auch die Jugend evangelisch reformierter
Religion im Herzogtum Preußen zur Pietät, christlichen, ehrbaren
Tugenden und anderen guten Sitten erzogen und auch in den humanistischen
Wissenschaften unter gebührender Disziplin mit allem Fleiß unverirret
und unverwirret bei Zeiten angeführt, unterwiesen und unterrichtet
werde."
Konkretes über den Unterrichtsbetrieb erfuhren wir erst ab Ende des
Jahrhunderts, ein Zeitpunkt, zu dem das Schulwesen allgemein in keiner
großen Blüte gestanden haben soll. Auch die Burgschule hat davon
offenbar keine Ausnahme gemacht.
Während der Pest in den Jahren 1709—11
waren die Schuldörfer fast gänzlich ausgestorben, so daß
den Lehrern ein Jahr lang gar kein Gehalt gezahlt werden konnte. Erst kurz
vor Ablauf des Jahres zahlte die preußische Regierung an die Schule
300 Thaler zur Unterstützung ... Es war auch (aus Sparsamkeitsgründen)
üblich, neu angestellte Lehrer geringer zu besolden, als ihre Vorgänger.
Der Streit zwischen den Konfessionen scheint im Laufe der Zeit abgenommen
zu haben, denn schon 1720 wurde an
der Burgschule der erste lutherische Lehrer, Hammerstein, eingestellt,
dem mehr und mehr Schüler und Lehrer folgten. Um 1800
betrug der Anteil der lutherischen Schüler schon 75 vH. und aus dem
Jahre 1809 erfahren wir, daß
die Schule große Schwierigkeiten hatte, überhaupt reformierte
Lehrer zu bekommen. Der Wandel zur praktisch konfessionslosen Schule wird
sich also bereits in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts vollzogen
haben.
„Daß von den Unterrichtsfächern
das Lateinische in den Mittelpunkt gestellt wurde, war schon dadurch bedingt,
daß die Prüfung, die bei dem Übergang zur Universität
von den Professoren abgehalten wurde, sich im Wesentlichen auf die lateinische
Sprache erstreckte",
lesen wir in der Geschichte der Burgschule. So besagt auch das Schulreglement
vom 23. April 1723:
„Sonderlich sollen die Schüler sich
nebenst der so nötigen und nützlichen Gottesfurcht in der Latinität
voll üben, damit sie in den künftigen examinibus und vorgängigen
exercitiis exploratoriis, so ihnen nach der erforderten Capacität
der Klassen, auch nach den wichtigsten Regeln syntaxeos in Beiwohnung auch
einiger Herren Kirchenältesten werden diktieret werden, nach Wunsch
bestehen mögen."
Die Anfangsgründe der Mathematik, sowie die historischen und geographischen
Wissenschaften wurden dagegen nur wenig betrieben. Es ging sogar soweit,
daß „derjenige Schüler, der im Lateinischen
auf der Prima saß, auch in Ansehung alles übrigen ein Primaner
war, wenn er auch darin ganz zurückblieb."
"Der Unterricht begann 'praecise Glock
sieben', in den Monaten Dezember und Januar um 8 Uhr mit einer gemeinsamen
Andacht im Schulsaal, wohin die Schüler, die sich 'bei Zeiten' in
ihren Klassen zu versammeln hatten, von den Klassenlehrern geleitet wurden..."
Der spätere Beginn in den Monaten Dezember und Januar war die Frucht
eines "Elternstreikes", über den zu lesen steht:
"Bis 1724 hatte der Unterricht für
das ganze Jahr um 7 Uhr begonnen; das war aber den Eltern offenbar wenig
genehm gewesen. Wenigstens setzten sie nach einem Schreiben des Rektors
Claeßen
vom 15. Januar 1723 der Ausführung dieser Bestimmung passiven Widerstand
entgegen. Trotz wiederholter Mahnung waren in den kurzen Wintertagen vor
8 bzw. 2 Uhr nur wenig Schüler zur Stelle. 'Und wenn man', so schreibt
Claeßen
weiter, 'mit Schlägen ihnen diese Kurzweil will vertreiben, so excusieren
sie sich teils mit Zetteln, von ihren Eltern geschrieben, teils drohen
sie, nimmermehr wiederzukommen, dergleichen auch schon passiert ist
und lassen noch höhnische und spitzfindige Wörter durch ihren
Diener oder Magd einem ins Haus hineinsagen'"
"Die Lehrart", so heißt es weiter,
"scheint, den Schulverhältnissen der damaligen
Zeit entsprechend, bei den Schülern nicht gerade Kurzweil erzeugt
zu haben, wenigstens fühlten sie das Bedürfnis, durch häufiges
Hinauslaufen etwas Abwechslung in den Unterricht zu bringen. In dem Schulreglement
hielt man es deshalb für angebracht, auf eine Einschränkung dieser
Unsitte hinzuwirken. Es sollte fortan „aus einer Klasse nur einem nach
dem anderen oder höchstens zweien zugleich hinauszugehen vergönnt
sein".
"Halbjährlich, und zwar zu Ostern und Michaelis,
fand ebenso wie an den anderen Lateinschulen ein öffentliches Examen
statt, wobei Prämien (praemia diligentiae) zur Verteilung kamen. Sie
bestanden in Tüten mit Rosinen und Mandeln oder in Papier."
Im Jahre 1755 beschloß man auf
Betreiben des Steuerrats Magirus, der Unregelmäßigkeiten
vermutete, statt
dessen klassische Bücher zu verteilen. Hiergegen haben aber die
Eltern offenbar protestiert, so daß später nach vielen Streitigkeiten
zwar in der Prima drei oder vier Bücherprämien im Werte von 18
Gulden, in den übrigen Klassen aber wieder Papier, Rosinen und Mandeln
verteilt wurden. Von 1776 bis 1791
wurden auf Anregung des Schulinspektors Andersch "zur
Aufmunterung des Fleißes der Jugend" bei jedem halbjährlichen
Examen Bücherprämien im
Werte von 10 Reichsthalern (gleich 30 Gulden) verteilt. 1791
zwang die Notwendigkeit, die Kollaboratoren besser zu bezahlen, von diesem
Brauch abzugehen.
Die Ferien waren nicht reichlich bemessen. Grundsätzlich wurde
vor- und nachmittags unterrichtet. Frei waren der Mittwoch- und Sonnabendnachmittag,
zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten einschließlich der Festtage
vier ganze Tage, ab 1723 nur noch drei
Tage. In der Jahrmarktswoche und den drei Wochen der Sommerferien fiel
der Nachmittagsunterricht aus.
Außerdem waren alle Nachmittage vor sämtlichen Festtagen
schulfrei: vor den vier Bußtagen fiel seit 1723
zum Ersatz für die "eingezogenen Apostel- und
anderen kleinen Feiertage" am Dienstag auch der Vormittagsunterricht
aus. Schließlich erhielten die Schüler, die bei der öffentlichen
Prüfung nicht durchgefallen waren, einen Tag zur "Recreation"
schulfrei. Diesen zeitlichen Beanspruchungen wichen die Schüler auf
ihre Weise aus. So schreibt der Rektor
Schävius am 2. März 1717
an das Kirchenkollegium, daß "zum öftern
Knaben aus der Schule blieben, von welchen man nicht wisse, ob sie dazu
erhebliche Ursache hätten oder nicht." Man müsse sich
mit den "excüsen", die die Schüler
beibrächten, begnügen, und so käme es dann vor, "daß
Kinder etliche Tage und Wochen ausblieben und den Eltern etwas vorlögen."
— "Etwas idyllisch", heißt es in der
Festschrift von 1914, "mutet
es uns an, daß keine Schlaguhr zur Regelung des Unterrichts in der
Schule war. Die Lehrer befanden sich offenbar auch nicht im Besitz einer
Taschenuhr, und so waren sie genötigt, Knaben auszuschicken, die nach
einer Stadtuhr sehen sollten. Daß diese, wie der Rektor Schävius
klagt, vielfältig eine so köstliche Gelegenheit wahrnahmen, um
sich zu vergnügen, zeigt uns, daß die natürlichen Triebe
bei der Jugend stets die gleichen gewesen sind."
Unter der russischen Besetzung während
des Siebenjährigen Krieges scheint der Schulbetrieb nicht
wesentlich gelitten zu haben. Während die Burgschule in den Jahren
1737-1773
nur jeweils 40 bis 50 Schüler gehabt hatte, stieg ihre Zahl in den
siebziger Jahren auf über 90 an. Im Jahre 1796
erhöhte sie sich auf 105 Schüler und hatte im Jahre 1801
112 erreicht. Zum großen Teil ist dies auf die Verwirklichung einer
Reform zurückzuführen, die im Anschluß an eine von Friedrich
II. im Jahre 1768 vorgenommene
außerordentliche Revision der "großen
Schulen in Königsberg" durchgeführt wurde. Grundlage für
die Reform an der Burgschule bildete die Instruktion des Hofpredigers Crichton
aus dem Jahre 1779.
Das Wirken Crichtons, der eine hervorragende
pädagogische Begabung besaß, war für die Schule bedeutend.
Seine Instruction war von
wirklich fortschrittlichen Gesichtspunkten beherrscht. Der Einfluß
Comenischer Schriften ist erkennbar. Über die Lehrer sagt er:
"Es ist nicht genug, sein Amt auf die Art wahrzunehmen, daß von
der Obrigkeit nichts dagegen gesagt werden kann, sondern ein jeder muß
es so gut tun, als er nur immer kann."
Und über den Unterricht:
"Anstatt daß man die veralteten
Schulmethoden und Schulsprache beständig beibehalten hat, sollte man
sich der besseren Einsichten des jetzigen Zeitalters bedienen, die alte
Wildheit und Barbarei einmal vergessen und den mildern Ton der gesitteten
Welt einführen..." Und weiter:
„Der Unterricht muß vernunftmäßig sein...Der
Unterricht sollte brauchbar sein ...Der Unterricht muß angenehm sein....Die
Strafen dürfen nie ohne Notwendigkeit geschehen...Nichts gelehret,
was die Kinder nicht verstehen. Alles dem Verstande, aber auch dem Herzen
empfohlen...Aller Orten muß Religion und nicht Theologie gelehrt,
und die Kinder müssen zur Gottesfurcht und nicht zum Religionshaß
angeführt werden ..."
Ein Faksimile der Crichtonschen Instruction
wurde der im Gebäude der Burgschule seit 1945
ansässigen SKOLA No 1 - jetzt GYMNASIUM No 1 - zum fünfzigjährigen
Bestehen der Schule 1995 überreicht.
Unter dem Rektorat Wannowskis 1779-1812
erlebte die Burgschule eine Blütezeit. E. T. A. Hoffmann, der
jüngere Hippel, Kanitz, Faber und der Maler Matuczewski
waren in dieser Zeit ihre Schüler. Am 8.
Februar 1786 drückte das Kirchen-Direktorium in Berlin
sein "Wohlgefallen über die Bemühung in
Aufrechterhaltung der Parochialschule und den eigenen
Unterricht in der Mathematik" aus. Die
Inspektoren
Andersch und Crichton schreiben am 30.
Juli 1789 in einer Eingabe an das Kirchen-Direktorium in Berlin,
"daß seit zehn Jahren die Schule immer in einem
guten Ruf gekommen sei." In einem Revisionsbescheid der Schulkassenrechnung
durch das Kirchen-Direktorium vom 16. Mai 1805
wird bemerkt, daß die deutsch-reformierte Schule zu den größten
und vorzüglichsten Königsbergs gehöre, und der Hofprediger
und Inspektor (und spätere Direktor der Schule) Weyl bemerkt
in einem Bericht vom 28. August 1811,
daß die Anstalt "besonders seit 30 Jahren unter
den gelehrten
Schulen der Stadt und der Provinz ihre Stelle
höchst ehrenvoll behauptet habe."
Beeinflußt von den Ideen der Aufklärung, wandte sich in den
letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts das allgemeine Interesse in höherem
Maße den Gelehrtenschulen zu. Neben einer Verbesserung der Methode
erstrebte man eine vernünftige Auswahl des Unterrichtsstoffes und
die Sicherung besserer Leistungen. Die realen Fächer gewannen gegenüber
den humanistischen weiter an Bedeutung. Zur Förderung des Schulwesens
wurde 1787 das Oberschulkollegium in
Berlin gegründet.
Eine Neuerung bedeutete die Einführung des Abiturientenexamens
im Jahre 1788. Bisher waren lediglich
Prüfungen an der Universität vorgenommen worden, die aber nicht
befriedigten. Vielfach hatten sich nur solche Schüler ein Abgangszeugnis
geben lassen, die sich um "Benefizien bewerben wollten",
es wurde also hauptsächlich von bedürftigen Schülern
verlangt. Die Vorschrift, daß nur Schüler mit Abgangszeugnis
immatrikuliert werden dürften, ist von der Universität zum Kummer
der Schulen nicht immer beachtet worden.
Die erste Abiturientenprüfung fand an der Burgschule 1789
statt, und zwar am 29. Juli die schriftliche
und am 5. August die mündliche.
Geprüft wurden die Schüler Stritzel, Böley,
Patschke
und Wenni, ihr Alter lag zwischen 17 und 19 Jahren. Die Prüfung
selbst können wir heute wohl als milde bezeichnen. So war in Mathematik
der pythagoräische Lehrsatz abzuleiten,
die Kubikwurzel aus einer gegebenen Zahl zu
ziehen und ein Proportional-Exempel
zu errechnen.
In Latein war eine Ode
des Horaz zu übersetzen und ein lateinischer Aufsatz zu schreiben.
Die Themen lauteten: De Ciceronis philosophia,
De
vitae brevitate und De juvenum officiis.
Der Aufsatz zum zweiten Thema ist noch erhalten. In Deutsch
schließlich gab es insgesamt fünf Aufsatzthemen. Das erste lautete:
"Schreiben eines Sohnes an seinen Vater, in welchem
er sich erklärt, warum er sich für tüchtig halte, zu höheren
Lehranstalten fortzugehen und warum er sich das Studium der Rechte gewählt
habe?"
Ein Kandidat schrieb dazu, "er hätte
sich gern der Gottesgelehrtheit gewidmet, wenn er sich nicht zu schwach
fühlte, den in diesem Fach des Studierens so häufigen und wichtigen
Unterweisungen der in der Bibel vorkommenden schweren und zweifelhaften
Stellen sich zu unterziehen .. - Die Medizin kann ich, wie Ihnen bekannt
ist, meiner Umstände wegen nicht studieren, und von einem Philosophen
habe ich eine viel zu große Idee, als daß ich mich unterstehen
könnte, dieses Fach zu wählen ..." Er wähle das Studium
der Rechte allein deswegen, weil ihm nur dieser Weg übrigbleibe und
weil er glaube, daß er dereinst in diesem Fach sich sowohl als ein
"brauchbares Mitglied der menschlichen Gesellschaft
als vorzüglich des Staats" werde zeigen können.
Die Bearbeitung des Themas "Beschreibung eines mit
Sturm und Gewitter kämpfenden Schiffes — sollte es wohl ein Bild einer
moralischen Erscheinung sein können?" wurde von allen vermieden,
auch das nächste Thema "Über die Freude
der Arbeitsamkeit" konnte keinen Anklang finden. Das folgende Thema
"Welch ein Glück Unschuld für einen Jüngling
sei"
wurde dagegen von einem Prüfling gewählt. Er wies darauf
hin, "wieviele Laster nicht täglich entstehen,
die meistenteils Jünglinge zuwege bringen und damit ihren Mitmenschen
schaden" und fordert "böse Gewohnheiten
abzulegen" und weist auf die Folgen hin, wenn der Jüngling
nicht "Lust hat, sich mit Unschuld zu zieren und
sich nicht bestrebt, unanständige Dinge
so früh als möglich abzulegen."
Auch das letzte Thema "Schreiben an einen Freund
über die Annehmlichkeiten des Landlebens" fand einen Bearbeiter.
Außer den Vorzügen der Hausmannskost für die Stärkung
der Gesundheit, die er darzustellen weiß, schreibt er, es sei "nicht
allein die Gesundheit das Vorzügliche des Landlebens, sondern auch
überhaupt die Annehmlichkeiten und das damit verbundene Vergnügen
auf demselben ist unbeschreiblich groß."
Über die mündliche Prüfung liegen keine Nachrichten vor.
Alle Prüflinge scheinen bestanden zu haben.
Die nächsten Abiturientenexamen fanden in den Jahren 1806
bis 1812 statt.
Nach dem unglücklichen Kriege wurde im Jahre 1809
eine Reform des gesamten Bildungswesens von Wilhelm v. Humboldt
angestrebt und in der Folge durchgeführt. Die Burgschule, die dem
Patronat der ev.-ref. Kirchengemeinde unterstand, sollte der Stadt übergeben werden, doch scheiterten die Verhandlungen schließlich
an dem Verhalten des Kirchenkollegiums, das keinerlei Privilegien an der
Schule aufgeben wollte, insbesondere das Recht Lehrer anzustellen und zu
besolden und nach wie vor über alle „oeconomica
der Schule" zu verfügen. Der Humboldt'sche Plan sah
vor, die Altstädtische Schule, das Friedrichskollegium
und die reformierte Lateinschule in Gymnasien
umzuwandeln, während die Löbenicht'sche
Schule zu einer Stadtschule
ohne gelehrten Charakter und die Kneiphöfische
Schule zu einer Handlungsschule für
die Kaufmannschaft umgeformt werden sollte.
Einerseits wollte in mehrjährigen Verhandlungen das Kirchenkollegium
seine Rechte nicht aufgeben, zum ändern war es nicht in der Lage,
die finanziellen Mittel für die Burgschule als Gymnasium aufzubringen.
Nach langem Hin und Her, verschiedenen Eingaben an den König u. a.
m. wurde die Burgschule 1813 in eine
Höhere
Bürgerschule umgewandelt. Das Friedrichskollegium
wurde als Gymnasium vom Staat übernommen, die Altstädtische
Schule wurde ebenfalls Gymnasium, während aus der Kneiphöfischen
und der Löbenichtschen Schule ebenfalls
höhere Bürgerschulen gemacht wurden.
Die Burgschule erfreute sich sogleich regen Zuspruchs. Direktor Büttner
übernahm die Leitung; er schreibt::
"Die neuorganisierte Anstalt bestand
aus vier Klassen. Die unterste, die Knaben von 7 oder 8 Jahren aufnahm,
wenn sie ziemlich gut deutsch lesen und die Buchstaben schreiben konnten,
beschäftigte sich mit den Gegenständen des Elementarunterrichts
und beabsichtigte eine Vorbereitung für die eigentliche Bürgerschule.
Diese begann erst mit der folgenden Klasse, indem Schulen dieser Art in
jener Zeit aus nicht mehr als drei Klassen bestehen durften.
Das Ziel der ersten Klasse und damit der ganzen
Anstalt ging dahin, ihren Zöglingen eine solche Bildung für Geist
und Herz zu gewähren, die sie im Alter von 15 bis 16 Jahren zum Eintritt
in die gewöhnlichen Berufszweige des bürgerlichen Lebens tüchtig
machte. Es wurden folgende Fächer gelehrt: Rechnen, Geometrie, Stereometrie,
Zeichnen, Schreiben, Geschichte, Gesang, Latein, Deutsch, Geographie, Naturbeschreibung,
Physik und Chemie, Religion, Französisch, Technologie, Polnisch für
reformierte Schüler aus Polen vorübergehend bis 1821, ferner
Biblische Geschichte und für künftige Kaufleute Produkten- und
Warenkunde, kaufmännischer Briefstil sowie Englisch und Russisch."
Uns will es heute scheinen, als ob mit diesen Fächern außer
denen der Grundschule und einer Objektschule auch solche einer Berufs-
und Fremdsprachenschule abgedeckt wurden. Auch die lateinische Sprache
wurde in keiner Weise vernachlässigt. Nach Direktor Weyl durfte
der Unterricht in der lateinischen Sprache auf keiner Stufe der Bürgerschule
fehlen, "da es im
ganzen Kreis der Unterrichtsgegenstände
kein so umfassendes, übendes und zur allgemeinen Ausbildung der Geisteskräfte
gleich wirksames Mittel gäbe, als nach dem Zeugnis der bewährtesten
Schulmänner die lateinische Sprache darbietet."
Schon 1813 hatte die Burgschule
110 Schüler, im folgenden Jahr bereits 200, auch nahmen viele Eltern,
die für ihre Kinder einen Beruf im Handel oder Gewerbe bestimmt hatten,
diese vom Gymnasium und schickten sie in die höhere Bürgerschule.
So kamen 1813 und 1814 30 bzw. 38 Schüler der Gymnasien zur Burgschule,
mehr als die Kneiphöfische Bürgerschule etwa im Jahre 1818 überhaupt
an Schülern zählte (26). Damals war die Burgschule nicht berechtigt,
ihre Schüler zur Universität zu entlassen, sie mußten noch
die oberen Klassen der Gymnasien durchlaufen. Zwar wünschten viele
Eltern, daß auch die Burgschule ihre Söhne in Nebenstunden für
die Universität vorbereite. Büttner schreibt, daß
die Burgschule dadurch
in "große Versuchung" geraten sei,
doch zog man es schließlich vor, die Zöglinge der Schule auch
weiterhin an die Gymnasien zu überweisen.
Nach 1819 erhält sie die Bezeichnung
"Burgschule". 1827
wird die Burgschule für den Abgang in bestimmte Berufe den Gymnasien
wieder gleichgestellt.
1842 erfolgte der erste Erweiterungsbau
der Burgschule. Der Erweiterungsbau war unzureichend und wurde 1843
in Benutzung genommen. Zwar erbrachte er ein Konferenzzimmer, das "bisher
gänzlich gefehlt hatte"; in einem Schreiben an das Kirchenkollegium
wird aber geklagt, "daß der Schule angehörende,
nicht unbedeutende Sammlungen von Büchern, Instrumenten und Naturalien
aus Mangel an geeignetem Raum in
den Lehrerzimmern, im Schulsaal und auf dem Hausflur
höchst unvorteilhaft und unzweckmäßig untergebracht seien,
mithin Bibliothek- und Instrumentenzimmer immer noch sehr schmerzlich vermißt
würden." Auch fehlte ein "für eine
höhere Bürgerschule sehr wünschenswertes Laboratorium zu
chemischen Versuchen." Eine weitere Verbesserung wurde aber nicht
herbeigeführt.
Der Grund zu einer Lehrerbibliothek war bereits 1790
gelegt worden, dank der "Freigebigkeit von Mitgliedern
der reformierten Gemeinde und anderer Wohltäter". Im Jahre
1806
waren 29 Bände vorhanden, darunter Schellers "Großes
lateinisches Lexikon" mit 7 Bänden, Jägers
"Zeitungslexikon" mit 3 Bänden,
Schneiders
"Griechisch-deutsches Lexikon" mit
2 Bänden, Pfeiffer & Nägeli "Gesanglehre",
Härtung
"Deutsche Sprachlehre",
Poppe
"Handbuch der Technologie" und der
"Physikalische Jugendfreund" mit 4
Bänden. Im Jahre 1844 enthielt
die Lehrerbibliothek 617 Bände mit besonders gut ausgestatteten Abteilungen
für Physik, Naturgeschichte und Geschichte, im Jahre 1910
umfaßte sie 4500 Bände.
Von einer Schülerbibliothek hörte man zum ersten Mal
etwas im Jahre 1837, sie umfaßte
damals 230 Bände, im Jahre 1844
aber bereits 784 und 1914 rund 2000
Bücher.
Eine Naturaliensammlung bestand seit 1779;
sie umfaßte eine zoologische und eine mineralogisch-geognostische
Abteilung. Zu der Sammlung gehörten u. a. 196 ausgestopfte Vögel,
ein Geschenk des Direktors Weyl, Amphibien und Fische in Spiritus,
eine Conchyliensammlung von 200 Nummern, eine Schmetterlingssammlung, ein
kleines oryktognostisches und geognostisches Kabinett mit 300 Nummern,
eine Sammlung von Fossilien, Gebirgsarten und Versteinerungen u. a. m.
Ein Verzeichnis über die Lehrmittel für den physikalischen
Unterricht wurde erstmals 1815
aufgestellt; und zwar gab es
"eine große elektrische Maschine
nebst Batterie, Isoliergestell, Glockenspiel und andere Apparate, ein Planetensystem,
ein Erdsystem, einen Kasten mit mathematischen Körpern, zwei Globen,
ein Prisma, eine Hand-Luftpumpe, eine kleine Elektrisiermaschine, ein Junkersches
Sonnen-Microscop, ein Magnet und drei große Zirkel."
1831 wurden angeschafft:
„eine Elektrisiermaschine nebst zwei
Konduktoren und Flasche, ein allgemeiner Auflader, ein Blitzgemälde,
zwei Scheiben zum elektrischen Tanze, elektrisches Pistol, Luftpumpe mit
zwei Stiefeln, Fallapparat für luftleeren Raum, Gefrierapparat, Cylinder
zum Regen, Heronsball, Kompressionspumpe, ein Pendel, 5 einfache Maschinen
nebst Friktionsapparat sowie ein Meßtisch nebst Ketten und Bussole."
Nach und nach wurden die Berechtigungen, die das Entlassungszeugnis
der Burgschule gewährte, weiter ausgebaut. 1841berechtigte
es zum Studium und der Staatsprüfung eines Wundarztes, während
für das Studium der Chirurgie und der Zahnarztkunde schon die Reife
für die zweite Klasse genügte. Zugleich bemühte man sich,
den Unterricht an den höheren
Bürgerschulen weiter zu verbessern.
Im Jahre 1847 wurden die Ferien
neu festgesetzt. Sie dauerten insgesamt neun Wochen, von denen auf den
Sommer 4, Ostern und Pfingsten 1.1/2 bzw. 1/2 Woche und auf Weihnachten
2 Wochen entfielen. Im übrigen waren nur noch der Krönungstag,
der Geburtstag des Königs und der Tag frei, an dem das Kollegium mit
den Schülern zum Abendmahl ging. Bei mehr als minus 20 Grad Reaumur,
25 C, fiel der Unterricht aus.
In der Mitte des Jahrhunderts stand die Burgschule "nach
allen Richtungen hin auf der Höhe", ab 1850
durfte sie ihre Abiturienten auch zur Kgl. Bauakademie entlassen.
Über die Schulfarben erfahren wir etwas von dem Vater Agnes Miegels,
Gustav
Adolf Miegel:
"Als Schulfarben hatten wir schwarz-weiß,
und zwar trugen wir schwarze Mützen mit weißer und schwarzer
Kante. Im Jahre 1848 publizierte aber die Prima 'schwarz-rot-gold', und
mit solchen farbigen Fahnen zog die ganze Schule zum Sommerfest (nach Wilky)
hinaus. Die Freude dauerte aber, wie manches Schöne in der Welt, nicht
lange. — Die Farben wurden
einfach verboten, und die Prima mußte sich
damit begnügen, zu dekretieren, daß dann die Farben der Schule
blau-rot seien",
(nach den Pariser Stadtfarben, die im Revolutionsjahr 1789
nach einer Rede Demoulins im Palais Royal von den Revolutionären
als Abzeichen genommen wurden). Zumindest bis 1856
ist es dabei geblieben, denn Miegel hat bis zu seinem Abiturientenexamen
ein blau-rotes, gesticktes Käppchen getragen. Im übrigen wird
noch bemerkt, daß Miegel, damals mit 76 Jahren einer der ältesten
Burgschüler, "noch jetzt mit großem Vergnügen"
an seine Schulzeit zurückdenke. Wann die Grün-gold-grünen
Farben eingeführt wurden, ist unsicher.
Im Jahre 1859 wurde die Burgschule
mit Wirkung vom 15. Oktober in den
neuen Schultyp einer Realschule erster Ordnung (I.O.) umgewandelt.
Der lateinische Unterricht in Sexta und Quinta wurde erweitert und das
Englische ab Tertia neu eingeführt.
Die Umwandlung der Schule vom Realgymnasium zur Oberrealschule war 1892
durch die Einführung einer lateinlosen Sexta begonnen worden und wurde
1902
abgeschlossen. Die Schule erhielt nun den Namen "Königliche
Oberrealschule auf der Burg".
Die Umwandlung in eine Oberrealschule sollte zu einer "größeren
Verallgemeinerung des realistischen Wissen beitragen". Die Oberrealschulen
waren den übrigen höheren Lehranstalten nunmehr völlig gleichgestellt,
nur bei ärztlichen Prüfungen mußte die Kenntnis der lateinischen
Sprache nachgewiesen werden. Auch wurde zum Eintritt in die Seeoffizierslaufbahn
in Englisch und Französisch das Prädikat "gut" verlangt, eine
Vorschrift, die später wegfiel. Für die Lehramtskandidaten wurde
1904
unter der Leitung von Direktor
Mirisch ein pädagogisches Seminar
eingerichtet. Ein Austausch zwischen deutschen und französischen Lehramtskandidaten
fand seit
1905 statt.
Der wieder auftretende Mangel an Raum führte in
den Jahren 1905 bis 1907 nach und nach zum Abbau der Vorschule,
auch wurde die Direktorwohnung in den Kreis der Schulräume mit einbezogen,
im Jahre 1913 wurde der wahlfreie Lateinunterricht
eingeführt.
Wenn mit der Verstaatlichung der Schule auch der finanzielle Druck aufhörte,
der früher über der Arbeit der Lehrer gelastet und sie beeinträchtigt
hatte, so war eine durchgreifende Verbesserung der räumlichen Verhältnisse
noch nicht eingetreten. Diese trat erst nach dem Einzug in den Neubau am
Landgraben ein. Während die Burgschule in dem Gebäude am Burgkirchplatz,
wenn wir das gemietete Haus an der Münze nicht berücksichtigen,
rd. 230 Jahre zubringen mußte und im Gebäude des Friedrichskollegs
immerhin auch über 30 Jahre eine Stätte gefunden hat, so blieben
ihr in dem neuen und modernen Haus am Landgraben keine 15 Jahre.
Die Schule am Landgraben entsprach in ihrem Grundriß den Maßen
der Restflügel der Ordensburg Lochstädt am Frischen Haff. Vielleicht
hat dieser Zusammenhang und ihr Name den Architekten dazu veranlaßt,
ihr äußerlich ein etwas burgartiges Aussehen
zu geben. Mutete die Turnhalle, aus bestimmter Perspektive gesehen,
nicht an, wie die Außenmauer einer Burg und der Turm wie der Turmstumpf
einer Ordensburg?
Über dem Haupteingang waren, von dem Bildhauer Wilhelm Ehrich
in Stein gehauen, die Köpfe von Kopernikus, Kant, Herder
und Corinth angebracht. Im Inneren dagegen brachte sie den Jugendstil
in dezenter Weise zum Ausdruck. Im Treppenhaus am Haupteingang befanden
sich Gemälde des Großen Kurfürsten und Hindenburgs.
Das neue Gebäude war modern eingerichtet und umfaßte etwa
16 Klassen. Es hatte eine große Aula mit Bühne, Empore, Orgel
und etwa 600 Sitzen, vor der Aula, von dieser nur durch Holzschiebewände
abgetrennt, einen schönen, sehr großen Musikraum, über
der Aula zwei Zeichensäle mit Nebenräumen, breite Flure, die
im Winkel der beiden Flügel und in der
Mitte des Hauptgebäudes sich zu Hallen weiteten und auch in den
Pausen innerhalb des Hauses nicht das Gefühl der Enge aufkommen ließen.
Außerdem verfügte das Gebäude über zwei Physikräume
mit allen Installationen und großen Nebenräumen, ähnlich
waren der Biologie- und der Chemieraum ausgestattet. Die Direktorwohnung
und die Wohnung des
Hausmeisters nahm der Bau ebenfalls auf. Unter der Aula befand sich
die Turnhalle, auch sie mit einer kleinen Empore, mit einem Zimmer für
den Sportlehrer, zwei Umkleideräumen und einem Duschraum. Im Erdgeschoß
waren u. a. auch ein Fahrradraum und ein Milchraum eingerichtet, wo man
beim Hausmeister Milch und Kakao erhalten konnte.
Außer dem großen Hof, der fast die Größe eines
normalen Fußballplatzes hatte und mit 100-m-Aschenbahn, Sprunggrube,
Recks und Barren ausgerüstet war, gab es auch einen Schulgarten, der
in den Biologiestunden bebaut und gepflegt werden sollte.
Außerdem standen dem Direktor und auch dem Hausmeister Gärten
zur Verfügung.
Gelegen war die Schule an einem Grünzug, dem Landgraben, der sich
bis Wargen hinzog und an dem auf eine Strecke von 10 km ein gepflegter
und schöner Spazierweg entlangführte. Über die Fürstenschlucht,
den Fürstenteich, den Hammerteich und die Zwillingsteiche stand er
in Verbindung mit der Villengegend Amalienau. Am Landgraben, in unmittelbarer
Nähe der Burgschule, lagen Tennisplätze. Sehr beliebt als
Mal- und Zeichenobjekte war ein altes strohgedecktes Bauernhaus unter uralten
Pappeln am Landgraben.
Von 1912 bis 1924 wurde die Schule
von Direktor Graz geleitet. Die Schülerzahl betrug in dieser
ganzen Zeit etwa 310 bis 340. 1924
war die Leitung der Schule von Direktor Draeger übernommen
worden. Zugleich mit der Übersiedlung in das neue Gebäude traten
einige Klassen des Hufengymnasiums, und zwar aus dem Zweig des Reformrealgymnasiums,
zur
Burgschule über. [So kam Heinz Labinsky zur Burgschule!]
Ab 1928 überstieg die Zahl der
Burgschüler wieder 500 und erreichte ihren höchsten Stand in
den Jahren 1929/30 mit 573. Im Jahre 1936
stand die Schule mit 551 Schülern an zweiter Stelle aller Königsberger
Oberschulen.
Im gleichen Jahre übernimmt Direktor Zerull die Leitung
der Schule. Sie wird umbenannt in "Oberschule
für Jungen auf der Burg". Von den vier ältesten Schulen
Königsbergs, dem Altstädtischen,
dem Kneiphöfischen Gymnasium und dem
Löbenichtschen
Realgymnasium liegt nun die Burgschule
nach der Zahl ihrer Schüler an der Spitze. Seit 1936
übertrifft sie
auch die Schülerzahl des Löbenichtschen
Realgymnasiums.
Seit Kriegsausbruch stand Direktor Falcke an der Spitze der Schule,
aber wie schon oft während des häufigen Direktorenwechsels und
nun auch während der Abwesenheit Dr. Falckes, lastet die Hauptverantwortung
und Hauptarbeit auf den Schultern von Oberstudienrat Hermann Lange,
der der Schule seit 1921 angehört.
Der Krieg bringt es mit sich, daß auf dem neu hergerichteten Schulhof
Wehrmachtsfahrzeuge abgestellt und Baracken gebaut werden, daß die
Turnhalle als Lagerraum für Getreide benutzt wird und bald auch die
Wehrmacht auf das Gebäude selbst Wert legt. Vorübergehend wird
der Unterricht im Hufengymnasium mit vier Schulen zugleich durchgeführt,
die sich im Laufe des Tages abwechseln. Später wird ein Teil der Schule
ihrem Zweck wieder zugeführt, aber die Spuren ihrer Benutzung durch
Nachrichteneinheiten sind recht deutlich.
Die Klassen lichten sich, kaum wird die Unterprima noch zur Versetzung
gebracht und die Zeit der Flakhelfer beginnt, der Unterricht findet in
den Scheinwerferstellungen um Königsberg statt.
Die Reihen der Lehrer und Schüler lichten sich immer weiter, und
am 22. Januar 1945 wird der Unterricht
eingestellt.
- Verantwortlich für den Text zeichnet OStD. Dr. phil. h.c. Friedrich Wilhelm Krücken -
|